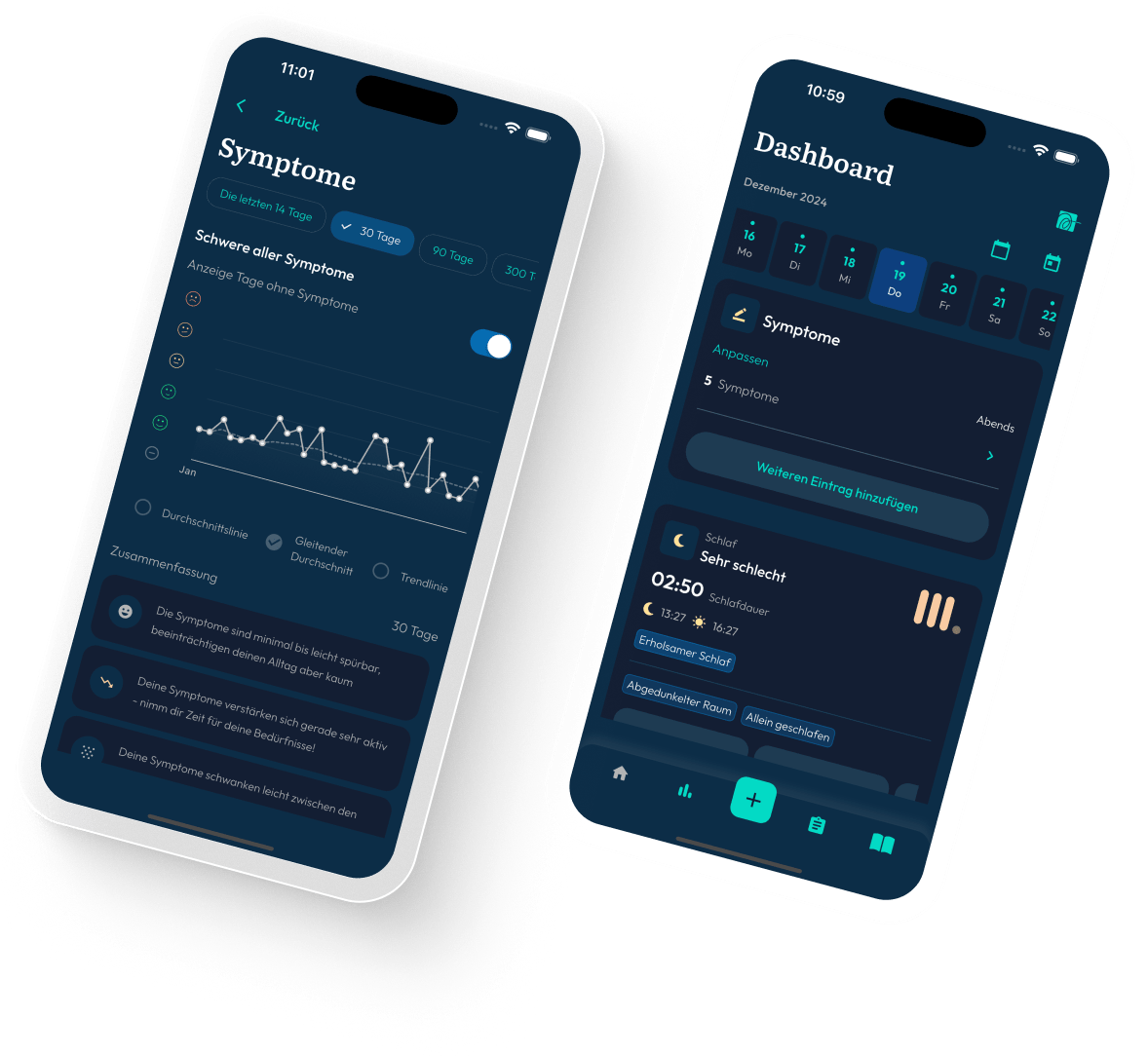IgG2 Biomarker: Bedeutung, Funktion und Laboranalyse - Laborwert, Normwerte und klinische Bedeutung
Der Biomarker IgG2 ist eine spezielle Unterklasse des Immunglobulin G, die im Rahmen der Labordiagnostik wichtige Hinweise auf das Immunsystem und chronische Infektionen liefert. Er wird eingesetzt, um Immundefekte zu erkennen und die Immunantwort bei Allergien oder Immunerkrankungen zu bewerten. Seine Bestimmung ist essenziell für eine präzise Diagnostik und individuelle Therapieplanung.
Kategorie: Immunsystem
Referenzbereich: 1.5 - 6.4
Was ist IgG2?
IgG2 ist ein Labormarker, der in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Er gehört zur Kategorie Immunsystem. Der normale Referenzbereich liegt bei 1.5 - 6.4.
Der Biomarker IgG2 ist eine spezielle Unterklasse des Immunglobulin G, die im Rahmen der Labordiagnostik wichtige Hinweise auf das Immunsystem und chronische Infektionen liefert. Er wird eingesetzt, um Immundefekte zu erkennen und die Immunantwort bei Allergien oder Immunerkrankungen zu bewerten. Seine Bestimmung ist essenziell für eine präzise Diagnostik und individuelle Therapieplanung.
Detaillierte Informationen zu IgG2
Ergebniserklärung
Was bedeuten niedrige Werte?
Was bedeuten hohe Werte?
Risikofaktoren für abweichende IgG2-Werte
- : Raucher haben tendenziell niedrigere IgG2-Spiegel, was das Infektionsrisiko erhöht.
- : Kinder mit IgG2-Mangel haben oft schlechte Antikörperantworten auf Impfungen (z. B. Pneumokokken), was zu häufigen Atemwegsinfekten führt.
- : Höhere IgG2-Werte können mit Insulinresistenz einhergehen.
Was kann bei abweichenden IgG2-Werten helfen?
- : Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, liefert die notwendigen Vitamine und Mineralien (wie Vitamin C, Vitamin D und Zink), die das Immunsystem stärken und eine optimale Funktion unterstützen.
- : Regelmäßige Bewegung verbessert die Durchblutung, reduziert Entzündungen und fördert die allgemeine Gesundheit. Moderate körperliche Aktivität kann das Immunsystem stärken und die Anfälligkeit für Infektionen verringern.
- : Schlaf ist entscheidend für die Regeneration des Körpers und die optimale Funktion des Immunsystems. Eine ausreichende Schlafdauer (7-9 Stunden pro Nacht) hilft, die Immunantwort zu regulieren und die Abwehrkräfte zu stärken.
Über Elara Health Laborwert-Datenbank
Elara Health bietet umfassende Informationen zu über 400 Labormarkern. Unsere Datenbank enthält Referenzwerte, klinische Interpretationen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen. Alle Informationen werden regelmäßig von medizinischen Experten überprüft.